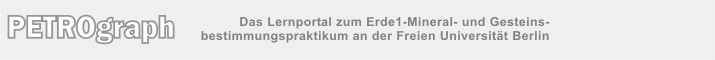Verwitterungsresistenz (Molteno, Südafrika). © D. Mertmann
Beschreibungs- und Bestimmungskriterien
Korngröße: Messen mit dem Zollstock, Lineal, Schieblehre, Vergleich mit
Korngrößentafeln, bei feinsten Korngrößen: Kautest. Ton zergeht auf der
Zunge, Silt knirscht leicht, Sand nicht mehr zu empfehlen.
Kornform: eckig bis gerundet.
Kornpackung: locker bis dicht.
Farbe: Einige Minerale färben das Gestein intensiv. Schon wenige
Prozent Eisen in dreiwertiger Form genügen, um eine rötlich-braune
Verwitterungsfarbe zu erzeugen. Daher immer auch auf die Farbe im
frischen Anschlag achten. Grau-schwarze Farben entstehen
meist durch fein verteilten Pyrit oder durch organische Substanz.
Sande erscheinen durch Mineralkörner mit Eigenfarben bunt; z.B.: Granatsand rot,
Olivinsand olivgrün, Glaukonitsand grün, Basaltsand schwarz, Hornblende- und Pyroxensand braun.
Festgesteine weisen dann ähnliche Farben auf.
Zusammensetzung und Grundmasse: Quarz ist sicher das häufigste Mineral
in siliziklastischen Sedimentiten. Hinzu kommen Feldspäte, Tonminerale,
detritische Glimmer und Chlorit, Gesteinsbruchstücke sowie Schwerminerale.
Letztere besitzen eine hohe Dichte und sind geeignet, Liefergebiete zu unterscheiden.
Zirkon, Turmalin und Rutil zählen zu den stabilsten Schwermineralen;
Staurolith und Epidot sind mäßig stabil; Amphibol, Pyroxen, Olivin sind sehr instabil.
Die Grundmasse hält das Gestein zusammen. Durch diagenetische Prozesse entsteht ein
kristalliner Zement, der aus den migrierenden Porenlösungen ausfällt.
Sein Chemismus kann sehr unterschiedlich sein. In Sandsteinen kann es Quarz-,
Feldspat-, Calcit-, Gips- und sogar Salzzemente geben. Die Matrix ist eine
feinkörnige, detritische Grundmasse, z.B. aus Pelit.
Strukturen und Fossilien: Kennzeichnende Sedimentstrukturen sind z.B. Lamination, Gradierung, Schrägschichtung. Fossilien können, wenn vorhanden, wichtige Milieuindizien liefern und eine weitergehende stratigraphische Einordnung ermöglichen.
Weiter mit: Konglomerate