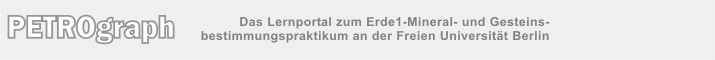für Geologische Wissenschaften, FU Berlin

Pelite
Ton- und Schluff-/Siltsteine werden auch zu Peliten zusammengefasst. Makroskopisch und mit der Lupe lassen sie sich nach ihrer Korngröße, kleiner 0,002 mm bzw. 0,002-0,063 mm, kaum differenzieren. Die geringfügig größeren Quarzkörnchen im Silt knirschen zwischen den Zähnen, während der Ton "auf der Zunge zergeht".
Die Färbung vieler Pelite wird durch Beimengungen anderer Substanzen hervorgerufen:
graue und schwarze Farbtöne meist durch fein verteiltes Eisensulfid und organische
Substanz (grau-schwarz), Verbindungen mit dreiwertigen Eisenionen (rot-braun) und zweiwertigen Eisenionen (grünlich).
Pelite bestehen zum größten Teil aus farblosen Tonmineralen (Schluffsteine aus mehr als 50 % und Tonsteine aus mehr als 75 %). Für eine genauere
Klassifizierung sind röntgenographische und/oder sogar rasterelektronenmikroskopische
Untersuchungen nötig. Nur diese führen zur Unterscheidung der verschiedenen Tonminerale.
Das wesentliche Zweischicht-Tonmineral ist der Kaolinit. Der Illit zählt gemeinsam
mit den quellfähigen Smektiten, u.a. dem Montmorillonit, zu den Dreischicht-Tonmineralen.
Der Chlorit vertritt die Vierschicht-Tonminerale.
Während der Diagenese spielt die Kompaktion, die Verdichtung des Sediments durch Auflast, eine wesentliche Rolle.
Die Porosität wird dramatisch herabgesetzt. Mit veränderten Porenlösungen gehen auch Umwandlungsprozesse
der Tonminerale selbst einher. So bildet sich z.B. Illit auf Kosten der Smektite.
Mit zunehmender Versenkung klingt die Kompaktion aus.