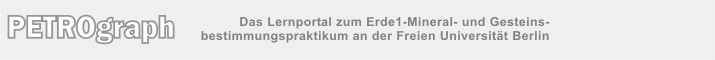© D. Mertmann

(Barbarossa-Höhle, Zechstein, Kyffhäuser). © D. Mertmann.

Teilweise sind die Evaporitlagen gefaltet (Schlangengips).
(Barbarossa-Höhle, Zechstein, Kyffhäuser).
© D. Mertmann
Gips- und Anhydritgesteine
Die Bezeichnung Gips steht sowohl für das wasserhaltige Mineral Gips als auch für ein Gestein (Gipsgestein, Gipsit). Letzteres weist oft ein kristallines Gefüge auf. Durch Beimengungen von Fremdmaterial (terrigenes, karbonatisches, organisches Material) können die Farben insgesamt oder in Lagen von weiß, hellgrau bis schmutziggrau variieren.
Das wesentliche Erkennungsmerkmal ist die geringe Härte der Gipskristalle (Mohssche Härteskala 2), so dass sich auch das Gestein mit dem Fingernagel ritzen lässt.
Weißes bis graues Anhydritgestein besteht im Wesentlichen aus Anhydrit, der wasserfreien Variante des Ca-Sulfats.
Es erscheint wegen der meist geringen Kristallgrößen marmorartig bis dicht. Es ist geringfügig härter als Gips, daher lässt es sich nicht mehr mit dem Fingernagel ritzen.
Beide Minerale können primär aus konzentrierten
Lösungen ausfallen. Heute können wir ihre Bildung in den
intertidalen Gebieten am Persischen Golf, in Tunesien und Ägypten beobachten.
Dort fällt Gips im Sediment am Boden von Lagunen und im Intertidal aus.
Die Kristallgrößen schwanken zwischen weniger als 1 mm bis zu mehr als 25 cm.
Bei steigender Evaporation werden die Gipskristalle durch Anhydrit ersetzt.
Dieser bildet zunächst ein feines Kristallgemenge aus. Weitergehende Umwandlung
führt zu dichten Anhydritknollen. Das Primärsediment wird zwischen den unregelmäßigen
Knollen zu verschlungenen Arealen reduziert (chicken-wire Anhydrit). Im landwärtigen
Teil der Küstenebenen fällt Anhydrit auch primär in dünnen Lagen oder Knollen aus. Am
Boden von Lagunen, Salzseen oder flachen Schelfarealen können riesige Gipskristalle einzeln oder als Zwillinge vertikal heranwachsen. Millimeter-dünn laminierte Gips- oder Anhydrit-Abfolgen enthalten als Trennlagen organisches Material, Karbonat oder terrigene Beimengungen. Die Schichtung kann dabei eben (Liniengips) oder eng gefältelt (Schlangengips) sein.
Gips- und Anhydritmaterial kann durch Wind und Wasser transportiert und resedimentiert
werden, so dass klastische Ablagerungen entstehen. Wir kennen Dünen und Rippeln aus
Gipskristallen sowie Ablagerungen resultierend aus Rutschungen, Schlamm- und
Schuttströmen, die verfaltet und brekziiert sind. Selten gibt es Gipsooide.
Durch Versenkung und Auflast entsteht aus Gips durch Verlust des Wasseranteils Anhydrit.
Allerdings kommt es bei erneutem Kontakt mit Wasser oder - schon das reicht aus! -
mit der Luft wieder zur Vergipsung; Anhydrit kann also in Gips zurückverwandelt werden.
Ein sichtbarer Ausdruck der Rückumwandlung von Anhydrit in Gips sind die von der
Höhlendecke herunterhängenden Gipslappen der Barbarossa-Höhle (Kyffhäuser, Harz).
Gips und Anhydritgesteine werden wirtschaftlich intensiv in der chemischen Industrie,
in der Zement- und Baustoffindustrie, zur Keramik- und Porzellanherstellung sowie für
kunstgewerbliche Zwecke genutzt.