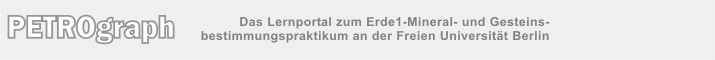Bildbreite etwa 20 cm. © D. Mertmann
Halitit
Halitit ist ein überwiegend monomineralisches Gestein aus Halit (Steinsalz).
Es kann derb mit einem kristallinen Gefüge in verschiedenen Farben von weiß,
grau bis rötlich (Beimengungen) auftreten. Die Kristallgrößen variieren im
Allgemeinen im mm- bis cm-Bereich. Kennzeichnendes Merkmal ist der salzige Geschmack.
Entsprechende Gesteine bilden sich in großen Salzbecken, Salzseen und Salzpfannen,
also sowohl marin als auch nicht-marin. In Ablagerungen tieferen Wassers ist der
Halitit meist wohl geschichtet oder laminiert. Diese Schichtung in Bänkchen
zwischen 3-5 cm ist durch einen lagenweise höheren Gehalt meist an terrigenem
Material, aber auch durch andere Salzmineral-Assoziation oder Anhydrit bedingt
(Liniensalze). Bei diffuser Verteilung von Verunreinigungen spricht man von
Schwadensalzen.
Halit-Ablagerungen heutiger Salzseen und Salzpfannen zeigen spezielle Abfolgen.
Überflutung führt zu einer teilweisen Auflösung der älteren Salzkrusten und zur
Hohlraumbildung in der Salzkruste selbst. Die entstandene Lösungsfläche wird von
einer dünnen Schlamm- und gelegentlich auch einer Gipslage überzogen. An
der Grenzfläche Lösung/Luft fallen aus dem stehenden, langsam eindunstenden
Wasserkörper erste Salzkristalle aus, die zu Boden sinken. Außerdem wachsen am Boden
Salzkristalle. Beide weisen eine charakteristische Struktur ineinander gestapelter Vs auf.
Es entsteht nach und nach eine Halitkruste, die durch anschließende Austrocknung in Polygone
zerfällt. Weiterer Halit fällt aus dem Grundwasser als klarer Zement aus und
verschließt Poren und Hohlräume im Untergrund.
Steinsalz-Ablagerungen werden und wurden bergmännisch abgebaut. Steinsalz findet
neben der Nutzung als Lebensmittel des täglichen Bedarfs und als Streusalz in der
chemischen Industrie (Waschmittel, Textil, Zellstoff, Papier) weite Verwendung.
Mächtige Lagerstätten kommen in verschiedenen erdgeschichtlichen Epochen vor.
In Europa zählen die bekannten permischen Zechstein-Salze dazu.
Weiter zu: Edelsalzgesteine