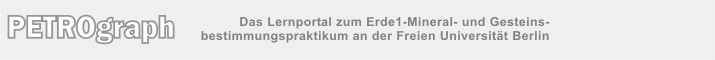© D. Mertmann.

Bildbreite 10 cm. © D. Mertmann.
Molluscen - Gastropoden, Pelecypoden und Cephalopoden
Gastropoden (Schnecken) sind in flachen Bereichen von
Schelfmeeren besonders häufig, doch gibt es sie auch in
Tiefseegebieten. Ursprünglich wohl rein marin lebend,
besiedelten sie seit dem Karbon auch Süßwasserareale und
den kontinentalen Bereich. In großer Menge, aber geringer
Artenzahl besiedeln sie so auch Gezeitenflächen, Seen,
Ästuare und andere Brackwasserzonen. Ihre Schale besteht
häufig aus Aragonit oder auch Calcit. Der Mantel kann
ein einheitlich spiral gedrehtes, napf- oder becherförmiges
Gehäuse absondern. Dieses kann außen glatt oder markant mit
Rippen oder Knotenreihen besetzt sein. Gastropoden ernähren
sich omnivor, carnivor oder vegetarisch, auf weidende,
beißende, saugende Weise von pflanzlichen und tierischen
Organismen. Mit etwa 170.000 rezenten und fossilen Arten
sind die Gastropoden die formenreichste Klasse der Mollusken.
Pelecypoden (Muscheln) besitzen als bilateralsymmetrische
Organismen ein zweiklappiges Gehäuse. Dorsal liegt das
Schloss mit Zähnen, Zahngruben und einem Ligament, das
die Klappen zusammenhält. Die Schale selbst besteht aus
Calcit und/oder Aragonit. Innerhalb derselben kann die
Substanz von Lage zu Lage wechseln. Das Gehäuse umschließt
den Weichkörper und schützt ihn. Seine Gestalt ist weitgehend
von der Lebensweise abhängig. Muscheln existieren sowohl als
Epifauna schwimmend, mit einer Klappe am Untergrund fixiert
oder mit dem Byssus befestigt, als auch als Infauna grabend mit
Siphonen oder bohrend. Gelegentlich bauen sie Riffe auf, z.B.
Rudistenriffe der Kreide. Die meisten Muscheln sind Filterer
von Phytoplankton, oder sie verwerten als Sedimentfresser
organische Substanz. Die ältesten Muscheln stammen aus dem
Kambrium.
Cephalopoden (Kopffüßer) sind in einigen pelagischen
Kalken des Mesozoikums und Paläozoikums typisch
(Cephalopodenkalke der Trias der Alpen, Ammonitico
rosso des Jura der Alpen). Die Schalen sind ursprünglich
aragonitisch. Das Gehäuse ist äußerlich glatt, berippt
oder mit Knoten oder Dornen skulpturiert. Im Inneren wird
es durch Kammerscheidewände in einzelne Segmente gegliedert.
Belemniten laufen an einem Ende spitz zu, bestehen aus Calcit
und zeigen eine deutlich radialstrahlige Struktur im Querschnitt.
Ammoniten kommt im Paläozoikum und im Mesozoikum eine große
Bedeutung als Leitfossilien zu. Die Zonenstratigraphie z.B. des Juras basiert
im Wesentlichen auf ihnen.